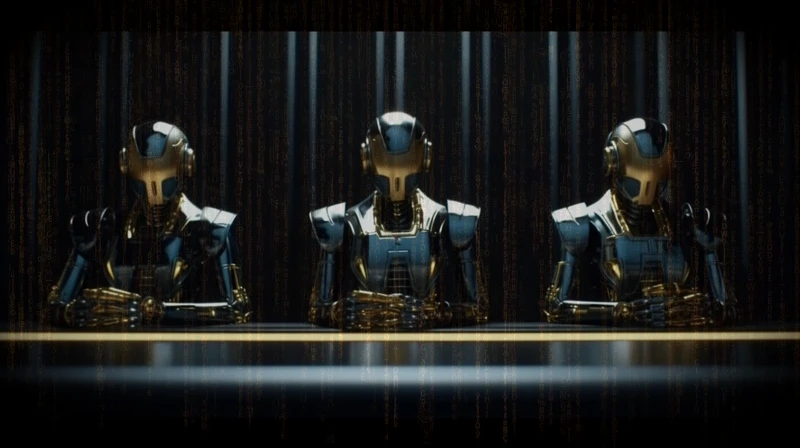Auch wenn ich jeden Tag Papierakten in die Hand bekomme, die mich nicht nur vom Material her sondern auch von der Auswahl der Ermittlungsmethoden an das letzte und vorletzte Jahrhundert erinnern, ist EDV ein fester Bestandteil der Polizeiarbeit. Polizeiliche Datenbanken speichern allerlei Daten zu Straftaten und zu Personen, angefangen bei den Namen und Adressen von Zeugen bis hin zu körperlichen Besonderheiten, politischer Orientierung oder der Einstufung von Beschuldigten als „BtM-Konsument“. Dass Ermittler solche Datenbanken, von denen aufgrund der föderalen Struktur der Bundesrepublik Deutschland viele länderweise geführt werden, bei Ermittlungen gegen eine Person abrufen, ist nicht neu und beim Vorliegen der konkreten rechtlichen Voraussetzungen im Einzelfall auch rechtlich unproblematisch.
Wie KI das Strafrecht in Zukunft prägen wird habe ich bereits ausführlich aufgeschlüsselt. Hier soll es nun darum gehen, wie KI im Strafverfahren von den Ermittlern eingesetzt wird.

Das magische Auge
Abseits des Einzelfalls bergen riesige Datenmengen auch das Potential, Muster im großen Ganzen zu erkennen, die ein einzelner menschlicher Betrachter gar nicht erfassen könnte. Solche Big Data versucht man zunehmend durch Data Mining, oft unterstützt durch Künstliche Intelligenz (KI), nutzbar zu machen. Die Macht solcher Big Data-Anwendungen liegt dabei vor allem darin, dass a) verschiedene Arten von Daten (z.B. Geo-Daten, Browserverläufe, politische Präferenzen oder sozioökonomische Daten wie Beruf und Einkommen) miteinander verknüpft und b) riesige Datenmengen in kürzester Zeit analysiert werden können. Während Sherlock Holmes die Daten, die er dann zur Verblüffung seiner Bewunderer messerscharf kombiniert hat, noch mühevoll selbst erheben musste, hinterlässt heutzutage jeder Nutzer freiwillig Unmengen von Daten im Netz und Computer finden innerhalb von Sekunden die Nadel im Heuhaufen.
Zuletzt ist die Software Gotham des US-amerikanischen Unternehmens Palantir in die Schlagzeilen geraten. Mit dieser Software soll es Sicherheitsbehörden möglich sein, Daten aus verschiedenen frei zugänglichen und polizei-internen Datenbanken sowie Ermittlungsergebnisse aus Einzelverfahren (z.B. aus einem Smartphone extrahierte Chats) zusammenzuführen und damit in einzelnen Verfahren viel konzentrierter und zeitsparender zu ermitteln als bisher. Darüber hinaus soll die Software auch Predictive Policing ermöglichen, also gezielte präventive Polizeiarbeit durch die Vorhersage, wo, wann und durch wen welche Straftaten zu erwarten sind.

Alte Vorurteile, jetzt digital
Man muss kein Aluhut-(Bedenken-)Träger sein, um sich vorstellen zu können, dass derartige Vorhersagen zur unbegründeten Verfolgung Unschuldiger führen können, wenn diese Personen in ein von der Software ermitteltes Raster passen: ergibt beispielsweise eine Analyse, dass in den vergangenen fünf Jahren die Mehrzahl aller Drogendelikte in einem Ein-Kilometer-Radius um den Bahnhof einer Stadt von Menschen einer bestimmten nicht-deutschen Nationalität begangen wurde, drängt es sich einerseits auf, polizeiliche Aufmerksamkeit rund um den Bahnhof auf Menschen dieser Nationalität zu konzentrieren. Andererseits würde das dazu führen, dass unzählige Passanten und Reisende, die den Bahnhof nutzen, wegen ihrer Hautfarbe oder anderer Äußerlichkeiten unter Verdacht gestellt werden. Weitere Faktoren, die die Datenanalyse aufgezeigt hat und die der Straffälligkeit viel eher zugrunde liegen könnten – z.B. Drogenabhängigkeit – sieht man den Menschen rund um den Bahnhof weit weniger an, sodass es deutlich schwieriger ist, diese bei der präventiven Polizeiarbeit zu berücksichtigen. Nutzbare Ergebnisse des Data Minings sind also nur die, die die Polizei mit auf die Straße nehmen kann. Wenn man Pech hat, sind das aber genau die Vorurteile, die wir in diesem Jahrhundert eigentlich hinter uns lassen wollten.
Ich sehe insofern die Gefahr, dass solche Stereotype wie der ausländische Drogendealer durch Nutzung moderner Polizei-Software einen pseudowissenschaftlichen Anstrich erhalten – also dass die Erkenntnisse, mit denen die Behörden arbeiten, nicht „besser“ werden, aber die Nutzer sich in deren Anwendung zu Unrecht bestärkt fühlen. Es kommt also (wie immer) darauf an, dass der Mensch vor dem Rechner das Denken nicht vollständig einstellt, nur weil ihm jetzt eine Maschine dabei hilft.

Gotham City am Main
Trotz aller Bedenken ist Palantir Gotham bereits in Deutschland angekommen. Unter der Bezeichnung hessenDATA soll es bereits seit 2017 in Hessen im Einsatz sein; andere Bundesländer sollen den Einsatz vorbereiten.
Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 16.02.2023 (1 BvR 1547/19, 1 BvR 2634/20; Pressemitteilung) entschieden, dass die Normen in den hessischen und hamburgischen Polizeigesetzen, die die (im Fall von Hamburg: geplante) Anwendung von Gotham regeln, verfassungswidrig sind. Da die Regelungen keine „ausreichende Eingriffsschwelle“ enthalten, die sicherstellt, dass die Software nur zum Schutz wichtigster Rechtsgüter „in begründeten Einzelfällen“ zur Anwendung kommen soll, verletzten sie das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1, Art. 1 Abs. 1 GG) derjenigen Personen, deren Daten analysiert werden. Interessanterweise hat das BVerfG also nicht den Einsatz der Software per se für grundrechtswidrig gehalten. Stattdessen müssten die Landesgesetzgeber „die wesentlichen Grundlagen zur Begrenzung von Art und Umfang der Daten und der Verarbeitungsmethoden selbst durch Gesetz vorgeben, anstatt die Güterabwägung im Einzelfall den Ermittlern zu überlassen. Sobald das „ob“ und „wie“ seines Einsatzes auf festen juristischen Boden gestellt wurden, kann der digitale Batman also auch das deutsche Verbrechen bekämpfen.
In Deutschland ist der Einsatz von Gotham nicht grundsätzlich verfassungswidrig. Der Gesetzgeber muss aber ausreichende Rechtsgrundlagen für die Anwendung schaffen.
Die Software und die Entscheidung des BVerfG haben großes Echo in der Presse und den sozialen Medien gefunden. Der YouTuber The Morpheus hat ein interessantes Video dazu gepostet, in dem er u.a. die technischen Möglichkeiten der Software sehr gut erklärt.
Aufgaben der Polizei
Neben einer gewissen Faszination für die Mächtigkeit der Software werden in solchen Reaktionen immer wieder Befürchtungen geäußert, dass in (naher) Zukunft eine Software quasi allein entscheiden könnte, wessen Wohnung durchsucht oder wer verhaftet wird. Die Bedenken sind grundsätzlich nachvollziehbar, aber ganz so unmittelbar wird die Software in unserem Rechtssystem keine Entscheidungen treffen. Die Gefahr liegt eher darin, dass menschliche Entscheider sich auf Computer verlassen statt die gelieferten Daten kritisch zu interpretieren.
Außerdem muss man bei der Diskussion im Blick haben, dass die Polizei in Deutschland zwei wesentliche Aufgabenfelder hat, auf denen sie software-mäßig unterstützt werden soll. Aufgabe der Polizei ist es, Kriminalität zu bekämpfen – vergangene und zukünftige. Bei den beiden Bereichen handelt es sich demnach um Strafverfolgung, also Ermittlungen zu konkreten stattgefundenen Straftaten, und Gefahrenabwehr, also Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung vor zukünftigen Straftaten. Damit korrespondieren die beiden Rechtsgebiete Strafrecht und Polizei- und Ordnungsrecht.
Betrachtet die Vergangenheit
mit dem Ziel der Sanktionierung sozialschädlichen Verhaltens.
Prüfungsmaßstab ist der jeweilige Straftatbestand (§).
Gerichte müssen sich eine sichere Überzeugung bilden, was geschehen ist
und dabei die Unschuldsvermutung berücksichtigen.
Beispiel: Ein Gericht stellt fest, dass eine Person unter Drogeneinfluss Auto gefahren ist und sich damit gemäß § 316 StGB wegen Trunkenheit im Verkehr strafbar gemacht hat.
Gestaltet die Gegenwart mit Blick in die Zukunft.
Soll öffentliche Sicherheit und Ordnung gewährleisten.
Prüfungsmaßstab ist eine Eingriffsnorm oder Ermächtigungsgrundlage (§).
Behörden müssen eine Lage beurteilen oder eine Prognose stellen um Maßnahmen zu ergreifen
und haben dabei Beurteilungs- und Ermessensspielräume.
Beispiel: Die Fahrerlaubnisbehörde, die erfahren hat, dass eine Person regelmäßig Drogen konsumiert, nimmt an, dass diese nicht fahrgeeignet ist und entzieht gemäß § 46 FeV (Fahrerlaubnis-Verordnung) die Fahrerlaubnis.
Je nachdem, in welchem der beiden Bereiche die Polizei gerade tätig ist, gelten unterschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen. Bei Gefahrenabwehr geht es darum, Risiken zu analysieren und präventiv zu handeln. Dass Computer in diesem Bereich helfen können Prognosen zu erstellen und polizeiliche Ressourcen gezielt da einzusetzen, wo sie gebraucht werden, kann man sich grundsätzlich gut vorstellen. Wenn es darum geht, aus solchen Modellen konkrete Maßnahmen abzuleiten, sind aber immer noch Menschen gefragt.
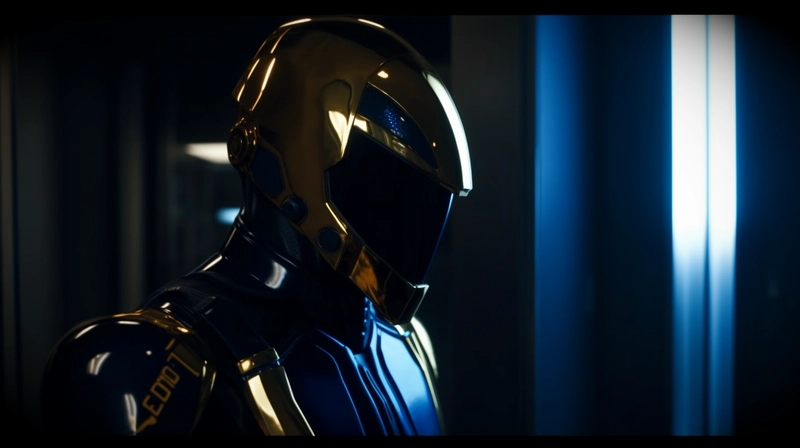
Digitales Profil als Beweismittel?
Im Bereich Strafverfolgung sehe ich den Einsatzbereich von Gotham und Co. aber deutlich eingeschränkter. Auch hier sollte man zunächst die verschiedenen Stadien eines Strafverfahrens unterscheiden: während im Ermittlungsverfahren Polizei und Staatsanwaltschaft einen Straftatverdacht klären und dabei, wie es immer so schön heißt, „in alle Richtungen“ ermitteln können, geht es dann im Hauptverfahren vor Gericht um den Tatnachweis, also die Strafbarkeit eines konkreten Angeklagten für eine konkrete Tat festzustellen oder ihn freizusprechen.
Ein Strafgericht verurteilt nur, wenn die Strafbarkeit des Angeklagten nach freier Würdigung aller Beweise (§ 261 StPO) zur sicheren Überzeugung des Gerichts feststeht. Der Tatnachweis muss dabei mit den sogenannten Strengbeweismitteln geführt werden: Zeugenaussagen, Sachverständigen-Gutachten, Urkunden (verlesbare Dokumente) und Augenschein (z.B. Fotos, Tatortbegehung).
Ein digitales Profil eines Angeklagten oder die Berechnung einer Software, dass eine Person mit den Eigenschaften des Angeklagten mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit die angeklagte Tat begangen hat, ist schon keines dieser Strengbeweismittel. Es stellt noch nicht mal eine Tatsache dar, sagt also nichts darüber aus, was der Angeklagte getan hat, sondern allenfalls, ob es in Anbetracht bestimmter Eigenschaften und seines früheren Verhaltens typisch für ihn wäre, etwas bestimmtes zu tun. Genau das – also die Einschätzung, wie wahrscheinlich es ist, dass der Angeklagte die angeklagte Tat begangen hat – ist aber die ureigenste Aufgabe des Tatrichters.
Nun könnte man auf die Idee kommen, dass geschulte Ermittler, die solche Polizei-Software nutzen, als Sachverständige im Strafverfahren auftreten könnten. Sachverständige sind Fachleute unterschiedlichster Disziplinen, die dem Gericht ihr Expertenwissen zur Verfügung stellen, wo dessen eigene Sachkunde zur Beurteilung von Tatsachen nicht ausreicht, beispielsweise Rechtsmediziner, forensische Psychiater oder IT-Forensiker. Die Expertise von Software-gestützten Ermittlern wird sich wohl darauf beschränken, die Software mit Daten zu versorgen, die Funktionsweise der Software (soweit möglich) nachzuvollziehen und die von der Software gelieferten Daten aus kriminalistischer Sicht zu interpretieren, wobei hierzu wohl kein akademisches Fachwissen erforderlich sein wird, das über die eigene Sachkunde eines Strafgerichts hinausgeht.
Digitale Profile sind kein Beweismittel im Strafprozess, mit dem der Tatnachweis gegen einen Angeklagten geführt werden kann.
Kurz: ich bezweifele, dass Software-gestützte Ermittler als Sachverständige im Strafverfahren, also als Strengbeweismittel zum Tatnachweis, zum Einsatz kommen werden. Ich gehe vielmehr davon aus, dass Digitale Täterprofile insofern das Schicksal der Operativen Fallanalyse (OFA, „Profiling“) teilen werden, die von der Rechtsprechung aus den genannten Gründen nicht als Beweismittel vor Gericht, sondern allenfalls als Werkzeug im Ermittlungsverfahren anerkannt wurde.

Kriminalistische Erfahrung, gestützt durch Data Mining
Die Nutzung digitaler Profile im Ermittlungsverfahren wird jedoch zunehmen. Hier wird meiner Ansicht nach auch der größte Einfluss der Polizei-Software auf menschliche Entscheidungsträger liegen. Die Software wird nicht entscheiden, wessen Wohnung durchsucht oder wer verhaftet wird, denn für solche Maßnahmen gibt es Richtervorbehalte. Wenn die Strafverfolger (Polizei, Staatsanwaltschaft u.a.) solche Maßnahmen durchführen wollen, müssen diese nämlich beim zuständigen Ermittlungsrichter beantragt und beschlossen werden. Grundvoraussetzung ist dabei jeweils ein Verdacht. Hier werden digitale Erkenntnisse eine wachsende Rolle spielen.
Im Strafverfahrensrecht unterscheidet man verschiedene Verdachtsgrade, die unterschiedliche Maßnahmen ermöglichen. Grundsatz ist: je stärker der Verdacht, desto höher die rechtlich zulässige Eingriffsintensität. So genügt bereits ein Anfangsverdacht, also die Möglichkeit, dass eine Straftat begangen wurde, für die Einleitung von Ermittlungen und die Vernehmung von Zeugen und Beschuldigten; auch für Durchsuchungen kann Anfangsverdacht (neben weiteren Kriterien) ausreichend sein. Um Anklage erheben zu können, also einen Beschuldigten vor Gericht zu bringen, braucht es schon einen hinreichenden Tatverdacht, d.h. die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung muss die eines Freispruchs überwiegen – und wenn es nur gefühlte 51% vs. 49 % sind. Für den extremen Grundrechtseingriff der Untersuchungshaft braucht man sogar dringenden Tatverdacht, also eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Beschuldigte die Tat begangen hat.
"zureichende tatsächliche Anhaltspunkte" für eine Straftat
§ 152 Abs. 2 StPO
ermöglicht z.B. Vernehmungen, Durchsuchungen
"genügender Anlass zur Erhebung der öffentlichen Klage"
§ 170 Abs. 1 StPO
ermöglicht Anklageerhebung
hohe Wahrscheinlichkeit der Tatbegehung
§ 112 Abs. 1 StPO
ermöglicht Untersuchungshaft
Ein Verdacht im Strafverfahren ist, wie im echten Leben, ein Knäuel aus Fakten und Vermutungen, wobei im Ermittlungsverfahren noch die Geheimzutat der kriminalistischen Erfahrung hinzukommt, also das kollektive Erfahrungswissen der Ermittler in einem bestimmten Bereich der Kriminalität. Ich habe oben dargestellt, dass vor Gericht die Beurteilung von Beweislagen die ureigenste Aufgabe der Richter ist und Sachverständige nur ihr Fachwissen zur Verfügung stellen, ohne selbst zu urteilen. Im Ermittlungsverfahren gilt dieser strenge Grundsatz noch nicht. Hier kommt es alltäglich vor, dass die kriminalistische Erfahrung zur Begründung eines Verdachts und damit zur Legitimierung von Ermittlungsmaßnahmen herangezogen wird. Das wird nicht selten von Verteidigern gerügt und führt dann regelmäßig auch zu Streit vor Gericht, wenn es um die Verwertbarkeit von Beweisen geht, die auf der Grundlage eines vagen Verdachts erhoben wurden. Grundsätzlich verboten ist es aber nicht, wenn die Ermittlungsbehörden auf der Basis begründeter Vermutungen agieren. Ganz im Gegenteil wäre es ihnen sonst nur möglich, Straftaten zu verfolgen, die von Anfang an voll beweisbar sind. Das würde absehbar dazu führen, dass viele Straftaten nicht aufgeklärt werden könnten.
Daher gilt, dass in jedem Einzelfall entsprechend dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit eine Abwägung stattfinden muss: während es bei schwersten Straftaten wie Mord möglich sein soll, die Ermittlungen auf dünner Tatsachengrundlage zu beginnen, sollen bei geringfügigen Straftaten erhebliche Grundrechtseingriffe wie Durchsuchungen nicht selbstverständlich sein.
In diesem Zusammenhang ist beachtenswert, dass laut gefestigter Rechtsprechung der Strafgerichte und des Bundesverfassungsgerichts der Anfangsverdacht einer Straftat aus legalem Verhalten abgeleitet werden darf. Prominentestes Beispiel der jüngeren Vergangenheit war der Fall Edathy: hier hatten die Ermittlungsbehörden den Anfangsverdacht des Besitzes kinderpornographischer Schriften daraus abgeleitet, dass der Beschuldigte Filme und Fotos im gerade noch so legalen Grenzbereich zur Kinderpornographie gekauft hatte. Die Anordnung von Durchsuchungsmaßnahmen beim Beschuldigten fußte auf dem Argument, dass nach kriminalistischer Erfahrung zu erwarten sei, dass Bezieher solcher Werke auch im Besitz eindeutig strafbarer Kinderpornographie seien. Das BVerfG hat mit Beschluss vom 15.08.2014 (2 BvR 969/14; Pressemitteilung) entschieden, dass hiergegen keine grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Bedenken bestehen. Die Fakten, die in einen Verdacht einfließen, müssen also selbst gar keine Tatsachen sein, die eine Straftat begründen.

Hier kommt die Software ins Spiel: aus den für Menschen unergründlichen Datenmengen über legales Verhalten, die policing software wie Gotham auswerten kann – z.B. Social Media, Online-Shopping – lassen sich Verhaltensprofile und unzählige neue Hypothesen zu möglichen Straftaten bislang völlig unverdächtiger Bürger generieren. Bei Beziehern fast-kinderpornographischer Filme werden vielleicht noch viele Menschen befürworten, dass die Polizei solche Leute unter die Lupe nimmt. Was ist aber mit Menschen, die extreme politische Ansichten haben, welche sie gewaltfrei und ohne die Begehung von Straftaten vertreten, aber online Kontakt zu gewaltbereiten Extremisten haben – sollen diese Personen auch polizeilichen Maßnahmen unterworfen werden, weil ein Computer sie für gefährlich hält? Soll bei Menschen, die bei Amazon gleichzeitig Tierabwehrspray, Kabelbinder und Sturmhauben bestellen, ohne weitere Erkenntnisse die Wohnung durchsucht werden, oder erst dann, wenn von ihnen auch bedenkliche Postings in fragwürdigen Foren bekannt sind? Sind Death-Metal-Fans per se gefährlicher als häkelnde Hausfrauen oder umgekehrt, und wie verschiebt sich der Risiko-Score, wenn eine häkelnde Hausfrau regelmäßig Krimis über mordende Ehefrauen herunterlädt und Rizinus-Samen bestellt?

Die Einschätzung, ob die aus der Datenmine geschürften Erkenntnisse im Einzelfall zur Rechtfertigung eines konkreten Grundrechtseingriffs ausreichen, muss nach wie vor ein Mensch treffen. Die Gesamtheit aller Richtergehirne in Deutschland hat aber garantiert bereits jetzt eine geringere Verarbeitungskapazität als die eingesetzte Polizei-Software. Bereits aus Kapazitätsgründen ist also nicht zu erwarten, dass in nächster Zukunft flächendeckend mithilfe von Big Data ermittelt werden wird. In den Kriminalitätsbereichen, in denen höchste Rechtsgüter betroffen sind und in denen daher traditionell am aufwändigsten ermittelt wird (Staatsschutzdelikte, Organisierte Kriminalität, Tötungsdelikte), wird die Verführung für die Behörden, immer mehr auf KI-gesammelte Erkenntnisse zurückzugreifen, aber immer größer werden.
Digitale Profile werden, wie bereits jetzt die „kriminalistische Erfahrung“, dazu dienen den Anfangsverdacht einer Straftat zu begründen. Damit werden Ermittlungsverfahren in Gang gesetzt und Maßnahmen wie Durchsuchungen gerechtfertigt.
Der beliebte Einwand, nur derjenige, der was zu verbergen habe, habe Angst vor der Polizei, gilt nicht: es liegt in der Natur der Big Data-Sache, dass in solchen Ermittlungen nicht nur die personenbezogenen Daten von Tatverdächtigen, sondern auch von unzähligen Unbeteiligten gesammelt, gefiltert und analysiert werden. Wenn es ums Ganze geht, kann und wird der Röntgenblick von Big Brother jeden treffen. Letztlich müssen wir also als Gesellschaft nach wie vor dem Argument widerstehen, dass der Zweck die Mittel rechtfertigt. Die Gesetzgeber in Bund und Ländern müssen also, entsprechend dem Urteil des BVerfG vom 16.02.2023, die genauen gesetzlichen Voraussetzungen zum Einsatz von Polizei-KI schaffen und die Rechtsprechung wird die Einhaltung dieser Grenzen im konkreten Einzelfall kritisch überwachen müssen.
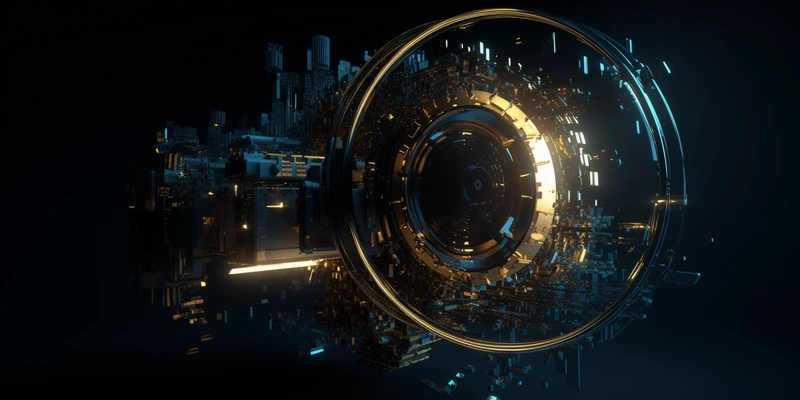
Fazit
Gotham und Co. werden in den nächsten Jahren auch in den deutschen Polizeibehörden Einzug halten. Einerseits ist nicht zu erwarten, dass digitale Täterprofile zur Verurteilung von Angeklagten herangezogen werden. Andererseits ist absehbar, dass insbesondere in Verfahren um höchste Rechtsgüter wie Leben oder Innere Sicherheit mit IT-generierten Erkenntnissen (in Strafverfahren) Verdachtsfälle begründet oder (im Polizei- und Ordnungsrecht) Gefährdungsanalysen generiert werden, die dann aber von menschlichen Entscheidungsträgern unbedingt kritisch hinterfragt werden müssen. Dass die Behörden solche Software nutzen ist nicht grundsätzlich verfassungswidrig.
Rechtsanwältin Andrea Liebscher